|
... Previous page
Thursday, 13. January 2005
ernste musik
kritikastern, January 13, 2005 at 11:21:24 AM GMT Am Anfang ein Abschied Konzerthaus: Wiener Symphoniker unter Adam Fischer Mahlers Sechste Symphonie ist für jeden Interpreten ein ganz schön großer Brocken. In den Händen von Adam Fischer und den Wiener Symphonikern blieb sie ein unüberschaubares Ungetüm. Das Konzert der Wiener Symphoniker unter Adam Fischer begann mit einem liebevoll choreographierten Abschied. Der Haydn-Spezialist Fischer setzte die berühmte „Abschieds-Symphonie“ des Meisters vor Gustav Mahlers Symphonie Nr. 6. Nur auf den ersten Blick eine beliebige Entscheidung: In der fatalistisch konsequenten Durchführung eines Konzepts sind beide Werke ebenbürtig. Haydn führt die Musik durch sich selbst ins Nichts, indem er die Musiker nach der Reihe abgehen lässt; auch Mahler findet keine Erlösung durch Musik, der mächtige Final-Satz endet ohne verklärende Schlussapotheose. Zudem beginnen beide Symphonien mit ruppigen Hieben der Streicher. Die kräftige Abwärtsbewegung am Beginn der „Abschieds-Symphonie“ ließ Fischer deutlich modellieren. Sofort war klar, was Haydn gemeint hat: Hier schlägt das Schicksal zu. Fischer entlockte dem Orchester schmerzvoll vibratolose Töne. Insgesamt schien man allerdings auf halbem Wege zu einem anderen Klangideal stecken geblieben zu sein, Intonationsmängel trübten das Klangbild. Mahlers „tragische“ Symphonie Nr. 6 ließ Fischer schroff und rau anheben. Die Marsch-Attacke sagt wie bei Haydn: Hier schlägt das Schicksal zu. Fischer artikulierte so hart, dass es im Sitzmöbel richtig ungemütlich wurde. Trotz großer Bemühungen reichte es jedoch nur für oberflächliche Fortissimo-Exzesse. Auch heftige Pump-Bewegungen des Dirigenten konnten der Musik nicht zu innerer Kraft verhelfen, die Wirkung blieb eine rein physikalische im oberen Dezibel-Bereich. Details überging Fischer: Der wirkungsvolle Dur/Moll-Kontrast, der die Symphonie dominiert, blieb über weite Strecken unbeleuchtet. Übergänge und Modulationen, die Schwellen zu neuen Klangwelten hätten sein müssen, blieben fast unbemerkt. Das Trio glotzte unschelmisch und bierernst. Allein die Soli des Konzertmeisters Florian Zwiauer deuteten an, wie es auch hätte klingen können: ironisch gebrochen. Eine Eigenschaft, die Mahlers Musik so einzigartig macht, die das Banalste nie banal klingen lässt. Zudem geizten die Symphoniker mit Klang-Pretiosen, manchen Fortissimo-Liegeton mit Crescendo formten sie gleichförmig, gelassen, in die Sessellehne gedrückt. Die Folge: Vor dem hilflosen Hörer türmte sich kein zerklüftetes Gebirge, sondern ein gleichförmiger, unüberschaubarer Fortissimo-Block. link me Monday, 20. December 2004
ernste musik
weichfest, December 20, 2004 at 1:40:25 PM GMT Debüt voll aufrichtiger Emotionalität Musikverein: Daniel Harding erstmals mit den Wiener Philharmonikern Jungstar Daniel Harding debütierte mit Mahlers Zehnter Symphonie als Dirigent der Wiener Philharmoniker. Die Erwartungen waren hoch. Kühn und klug wählte Daniel Harding sein Einstandswerk bei den Wiener Philharmonikern. Gustav Mahlers nicht vollendete Zehnte Symphonie ist ein Dokument größten Schmerzes und gehört zu den bestaunenswertesten Orchesterwerken. Die „Zehnte“ ist keine „Unvollendete“ im eigentlichen Sinn. Mit Ausnahme des ersten Satzes ist sie als vollständiges Skelett überliefert. Das einleitende Adagio konnte der Komponist noch instrumentieren, die Sätze zwei bis fünf sind nur als harmonisches und melodisches Gerüst überliefert. Jede Aufführung kann nur eine Werkumkreisung sein und muss mit einer Instrumentation aus zweiter Hand arbeiten. Wie die meisten Dirigenten wählte der 29-jährige Brite Deryck Cookes Version. Mahlers Zehnte ist, gleich allen großen Kunstwerken, für verschiedenste Projektionen offen. Biografisch gesehen ist sie eine Erzählung von Weltschmerz und Verzweiflung. Mahler erfuhr zur Entstehungszeit vom Verhältnis seiner Frau Alma mit Walter Gropius. Das Manuskript ist voll flehender Eintragungen („für dich leben! für dich sterben! Almschi“). Auch aus analytischer Perspektive ist das Werk bedeutend: Es öffnet mit einem markerschütternden Neunton-Akkord die Tür zur Moderne und übertritt diese Schwelle im letzten Satz mit isolierten, krachenden Trommelschlägen. Und es ist Ausdruck verzweifelter Leidenschaft, Entsagung, erfüllter Selbstaufgabe. Im Paradox eines nicht vollendeten Kunstwerks sind diese Gefühle vollendet erfasst. Das klangliche Erscheinungsbild der Wiener Philharmoniker ist von einem Generationswechsel geprägt. Bei den Streichern trifft ein Noch-Nicht-Ganz auf ein Nicht-Mehr-Wirklich. Das einleitende Solo der Bratschen wirkte technisch nicht souverän. Dem großen warmen Klang, für den die philharmonischen Streicher bekannt sind, näherte sich die Orchestergruppe erst im letzten Satz. Im Piano- und Pianissimo-Bereich vermochten sie Harding hingegen präzise zu folgen, klanglich atemberaubend unverschleiert. Die Bläser musizierten intonationssicherer und markanter als ihre Streicherkollegen: Jedes Horn-Solo ein Ereignis, jeder Trompetenstoß ein kleiner Schock, jede Posaunenfigur plastisch geformt. Und wären da nicht die engen Stuhlreihen gewesen, man hätte sich während des bekannten Flötensolos des letzten Satzes heulend auf den Boden geworfen, so erschütternd schön war das. Debütant Daniel Harding scheint das Vertrauen der Musiker erobert zu haben. Untrüglich stellte sich das Gefühl ein, dass der Dirigent trotz seiner Jugend das Orchester an die Qualität einstiger Glanzzeiten heranführen kann. Harding, der Mahlers Zehnte zuvor mit verschiedenen Orchestern aufgeführt hat, spielte seine Vertrautheit mit dem Werk aus: Seine Interpretation verband die Ausformung musikalischer Details mit untrüglichem Gespür für musikalische Sogwirkungen, bestach durch abgefederte Tempoübergänge und eine musikantische Überzeugungskraft, die nicht nur das Orchester fesselte. link me Friday, 17. December 2004
oper
weichfest, December 17, 2004 at 10:56:34 AM GMT Wenn das Publikum selbst zum Instrument greift Konzerthaus: Salieris „Europa riconosciuta“ unter Tiziano Duca Die „Konzertvereinigung im Wiener Konzerthaus“ nimmt sich heuer drei Salieri-Opern vor. Die konzertante Serie wurde mit „Europa riconosciuta“ eröffnet. Was sind tausend falsche Töne gegen das Leuchten in den Augen von Musikern, für die der Jubel des Publikums nichts Alltägliches ist? Einerseits. Andererseits muss der Zuhörer sie ertragen. Die falschen Töne. Naturgemäß gab es derer einige beim Konzert der Konzertvereinigung im Wiener Konzerthaus. Denn die Konzertvereinigung rekrutiert ihre Mitglieder aus dem Konzerthaus-Publikum, engagierten Musikern und Enthusiasten. Das Laienorchester wurde 1985 auf Anregung Alexander Pereiras gegründet. In dieser Saison erwirbt man sich Verdienste um einen großen, zu Unrecht in falsches Licht gerückten Komponisten: Antonio Salieri. Seine Opern „Falstaff“ und „La Grotta di Trofonio“ werden zu hören sein, mit „Europa riconosciuta“ wurde die dreiteilige Opern-Serie im Neuen Saal des Konzerthauses eröffnet. Ein Werk, das gerade an der Mailänder Scala auf dem Spielplan steht, weil es für die Eröffnung jenes Hauses geschrieben worden war. Mit „Europa riconosciuta“ vermied Salieri starre Formschemata und entsprach so den modernen Opernidealen Glucks. Inhaltlich unterscheidet sie sich durch nichts von den damals üblichen Prunk-Opern. Nun nahmen die Konzertvereinigung und der Wiener Motettenchor eine Wiederbelebung vor. In der Tat wurde das 1778 entstandene Werk zu ein paar kräftigen Herzschlägen angeregt. Dazu trugen vor allem die Sänger bei: Ana Durlovski machte als Europa die beste Figur. Sie hatte ihre Sopranpartie fest im Griff. Nicht ganz so die Sopranistin Anna Kowalko: Sie zeigte zwar in der Mittellage großes Potential und mitreißende Musikalität, ihre Stimme klang aber in den höchsten Höhen noch höchst unausgereift. Magdalena Meziner und Maren Engelhardt sangen anständig, Roman Payer blieb als Einspringer für Manfred Equiluz farblos. Dirigent Tiziano Duca rackerte nach Leibeskräften, um die Chose zusammen zu halten. Im ersten Akt gelang das noch ganz gut. Im abschließenden zweiten, dramatischeren Akt, der sich musikalisch durch rasch wechselnde Tempi auszeichnet und sich auf der Opernbühne sicher gut machen würde, gelang das immer weniger. Auch wenn die Stimmführer kräftig ruderten: Die Hintermannschaft kam gehörig ins Trudeln. link me ... Next page
|
online for 8543 Days
last updated: 8/8/05, 6:22 PM  Youre not logged in ... Login

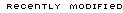
Oper als Erotikthriller Wien: "Don
Giovanni" unter Bertrand de Billy So wie man "Don Giovanni"...
by kritikastern (7/24/06, 3:45 PM)
England liegt im arktischen Affen-Fieber
Sind die Arctic Monkeys die neuen Beatles? Pop-Hype um „Arctic...
by weichfest (3/8/06, 12:55 AM)
Die kleine Schwester der „Entführung“
Donaufestwochen im Strudengau: Mozarts „Zaide“ Die Donaufestwochen im Strudengau nahmen...
by weichfest (8/8/05, 6:22 PM)
Die Welt wird Musik Klangbogen:
Giora Feidman Trio Der Klarinettist Giora Feidman hat Klezmer zu...
by weichfest (8/8/05, 6:21 PM)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||