|
... Previous page
Friday, 23. April 2004
oper
weichfest, April 23, 2004 at 1:43:03 PM BST Kammeroper: Cavallis „Die Liebe des Apollon und der Daphne“ Nicht zeitgemäß, sondern kindisch Die Kammeroper, die sich um die in Wien vernachlässigte Barockoper annimmt, hat anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums „Die Liebe des Apollon und der Daphne“ von Francesco Cavalli (1602-1676) wiederaufgenommen. Der Komponist hat Monterverdis kompositorischen Weg weitergeführt, sein Opernstil verwischt die Grenzen von Rezitativ und Arie. Das Programmheft sieht – nicht zu Unrecht – in heutigen Soap-Operas Parallelen zum Lieben und Leiden der Götter in Busenellos Libretto. Die Inszenierung trifft jedoch leider nicht das „heutige Leben“, sondern nur eine Klischeevorstellung davon. Über weite Strecken erinnert das kindische Treiben auf der Bühne an ein Gastspiel von „Confetti TiVi“. Die in der Musik angelegten poetischen Momente (etwa die finale Umwandlung Daphnes in einen Lorbeerbaum) finden keine adäquate optische Umsetzung. Ihre akustische jedoch schon: Das Orchester der Kammeroper spielt auf Originalinstrumenten unter der profunden Leitung von Bernhard Klebel schwungvoll und klanglich ausgewogen. Das Bühnenbild von Otto Sujan, eine Serie von Wolken-Prospekten, wird vom Kampf Leuchtstoffgrün gegen Himmelblau dominiert. Ästhetisch könnte das höchstens als 80er-Jahre-Reminiszenz durchgehen, war aber hier wohl nicht so gemeint. Die Lichregie ist zudem manchmal etwas unpräzise: Füße werden beleuchtet, Köpfe nicht. Das Urteil über die Sängerleistung muss zwiespältig ausfallen: Bei mancher Nebenrolle steht, trotz musikalisch schlüssiger Ausarbeitung, noch eher das Wollen als das Können im Vordergrund. Überzeugen können Raquela Sheeran (Daphne) und Alexandra Rieger (Aurora), die beide ihr Kammeropern-Debüt geben. Die überzeugendste Männerstimme des Abends: Sokolin Asllanajs markiger Bariton. Gernot Heinrich gefiel mit seinem schlanken, agilen Tenor, Alexander Plust war als Apollon ein verlässlicher Counter-Tenor. link me ernste musik
weichfest, April 23, 2004 at 1:42:08 PM BST Brahms-Saal: Ensemble Kontrapunkte, Keuschnig, Lucas Buntes Stil-Potpourri aus dem 20. Jahrhundert Ein interessantes Allerlei an Kompositionsstilen des vergangenen Jahrhunderts servierte Ensemble-Kontrapunkte-Leiter Peter Keuschnig im fünften Konzert seines Musikvereins-Zyklus. Wenig erfreulich war die Umsetzung von Gerhard Schedls „Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden...“, einem Lamento für Violine, Violoncello, und Klavier über ein rätselhaftes Thema aus Mozarts „Zauberflöte“. Das Zitat stammt aus dem 28. Auftritt der Oper, der schaurig schönen Musik der „Geharnischten“ zur Eröffnung der Feuer- und Wasserprobe. Das Klaviertrio ist ein kurzes Stück, umso präziser und verfeindert ist Schedls Klangsprache. Schedl, der im November 2000 freiwillig aus dem Leben schied, verlangt hier komplexe Spieltechniken. Die Interpretation durch das Ensemble Kontrapunkte war nur eine Annäherung an die klanglichen Intentionen, jedoch keine adäquate Umsetzung. Musikalisch geglückt hingegen Bruno Madernas „Konzert für zwei Klaviere und Orchester“: Die Pulsierende Rhythmik des Werkes entwickelte in der Interpretation durch Klara Torbova und Tomislav Nedelkovic Baynon am Klavier und dem Maderna-Schüler Keuschnig am Dirigentenpult einen mitreißenden Sog, klanglich fein mit dem Schlagwerk verwoben. Noch vor der Pause erfolgte ein abrupter Sprung in die Vor-Atonale Phase Arnold Schönbergs: Michaela Lucas glänzte mit dem „Lied der Waldtaube“ (in der Version für Kammerorchester) aus den Gurre-Liedern. Höchst expressive Gesangslinien standen jedoch einer etwas verminderten Wortdeutlichkeit gegenüber. Mit Schostakowitsch holte sich das Ensemble schließlich den ausgelassenen Jubel des Publikums: Zunächst erklang die „Suite für Jazzorchester“ Nr.1 des russischen Komponisten, an der musikalisch noch sehr zu feilen gewesen wäre. Auch technisch passierten hier grobe Unsicherheiten, der Erste Geiger schummelte sich mehr schlecht als recht über die Hürden seiner Soli. Schwungvoll und mitreißend musiziert wurde schließlich die „Suite für Promenadenorchester“, die Ballett-, Unterhaltungs- und Filmmusik von Schostakowitsch aus mehreren Jahrzehnten vereint. Raffinierte Stücke, die das virtuose Handwerk und die Genialität Schostakowitschs in jeder Sekunde aufblitzen lassen, Musik, von der noch Generationen von Filmkomponisten zehren. Zwar mit Ausrutschern ins derbe, aber durchwegs schmissig ließ Keuschnig durch die Partitur wirbeln. Zum großen Vergnügen des Publikums: Man hätte gern mehr als eine Zugabe gehört. link me Tuesday, 20. April 2004
theater
weichfest, April 20, 2004 at 12:09:15 AM BST Schauspielhaus: Das verräterische Herz Atemberaubender Monolog nach E.A. Poe Dunkelheit. Fast unmerklich fällt ein feiner Lichtstrahl auf ein Gesicht, das körperlos im schwarzen Nichts der Bühne zu schweben scheint. Regisseur Barry Kosky gibt dem Publikum zunächst einmal Zeit, sich auf das einzulassen, wovon es gefesselt sein wird: Martin Niedermairs Gesicht. Eine Holzstiege, ein paar Scheinwerfer und ein Klavier. Mehr brauchen Barry Kosky und sein Darsteller Martin Niedermair nicht, um aus Edgar Allan Poes kurzem Text "Das verräterische Herz" einen schaurig fesselnden und präzisen Theaterabend zu machen. "Es ist wahr!" So lautet der erste Satz dieses inneren Monologs von Poe, mit dem Kosky und Niedermair tief in die psychologischen Abgründe eines geisteskranken Mörders vordringen. Das Verbrechen wird an einem alten Mann begangen, dessen Blick der Erzähler nicht ertragen kann. Der Mörder, von einem überempfindlichen Gehörsinn gequält, erzählt, wie er den Alten zerstückelt und unter Bodendielen versteckt hat. Als die Polizei kommt, glaubt er, das Herz des Getöteten pochen zu hören - und verrät sich. Bewundernswert präzise setzt Barry Kosky, verantwortlich für Regie, Licht und Musik, einfache theatrale Mittel ein. Martin Niedermair sitzt still auf einer langen Holztreppe. Alle Bewegung passiert, außer während kurzer und umso intensiverer Ausbrüche, im Gesicht des ausgebildeten Musical-Sängers. Das Sehen ist auf den Kopf des Darstellers und seine nervösen Ticks konzentriert, das Hören auf seinen mikrofonverstärkten Sprechapparat. Sein Zähneklappern, Zungenschnalzen, Knirschen und Schmatzen hallt durch den atemlos stillen Raum. Höchste Spannung erzeugt Niedermair auch durch eine Interpretation des Textes, die jedem Wort Raum und Zeit gibt, sich im Kopf des Publikums als Bilder zu manifestieren. Jede Silbe wird auf ihren emotionellen Gehalt abgeklopft, der rechte Subtext gefunden. In die Erzählung hat Kosky, der selbst am Klavier begleitet, Musik von Bach, Purcell, Kreisler und Wolf eingeflochten. Das sorgt für fesselnde Momente und gibt Niedermair die Möglichkeit, sein umfassendes Können als Sänger (sogar kopfüber auf der Treppe liegend) unter Beweis zu stellen. Im liebevoll gestalteten Programmheft finden sich Bilder von Francis Bacon. Von ihnen lässt sich sagen, was auch für diese Produktion gilt: Beide zeigen das unsichtbare, von Wahnsinn und Weltschmerz gezeichnetes Gesicht hinterm Gesicht eines Menschen. link me ... Next page
|
online for 8544 Days
last updated: 8/8/05, 6:22 PM  Youre not logged in ... Login

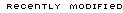
Oper als Erotikthriller Wien: "Don
Giovanni" unter Bertrand de Billy So wie man "Don Giovanni"...
by kritikastern (7/24/06, 3:45 PM)
England liegt im arktischen Affen-Fieber
Sind die Arctic Monkeys die neuen Beatles? Pop-Hype um „Arctic...
by weichfest (3/8/06, 12:55 AM)
Die kleine Schwester der „Entführung“
Donaufestwochen im Strudengau: Mozarts „Zaide“ Die Donaufestwochen im Strudengau nahmen...
by weichfest (8/8/05, 6:22 PM)
Die Welt wird Musik Klangbogen:
Giora Feidman Trio Der Klarinettist Giora Feidman hat Klezmer zu...
by weichfest (8/8/05, 6:21 PM)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||